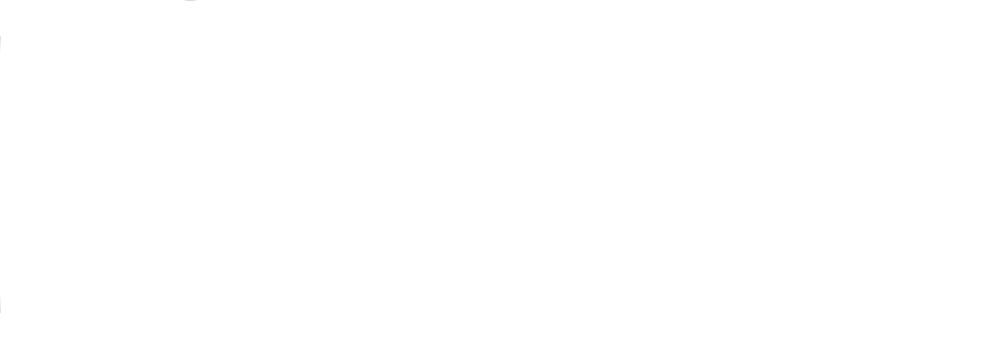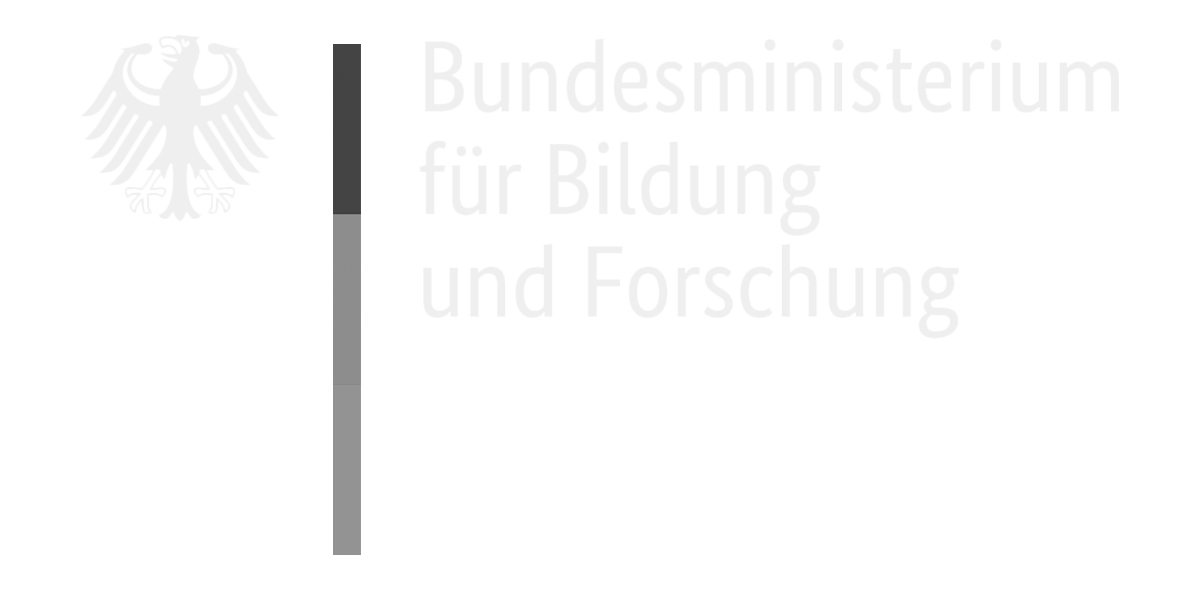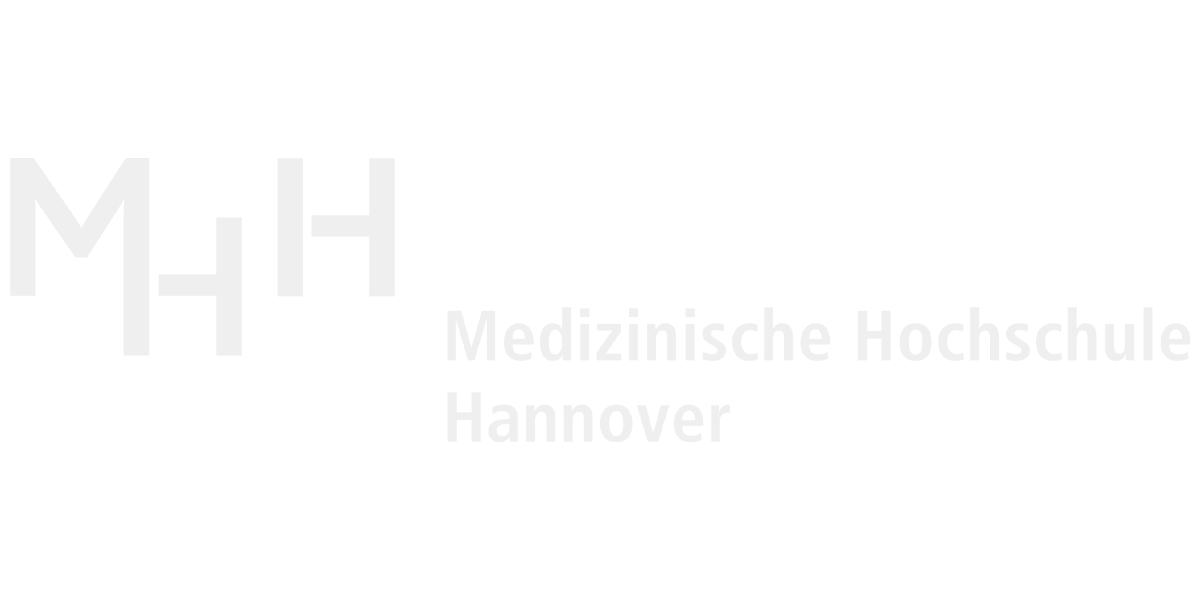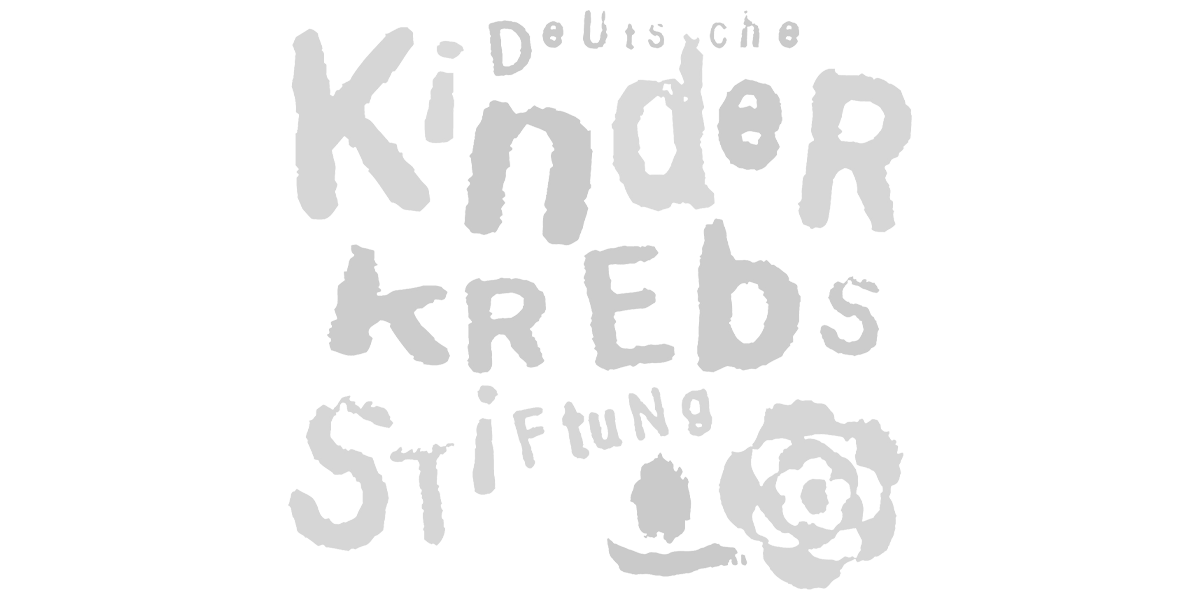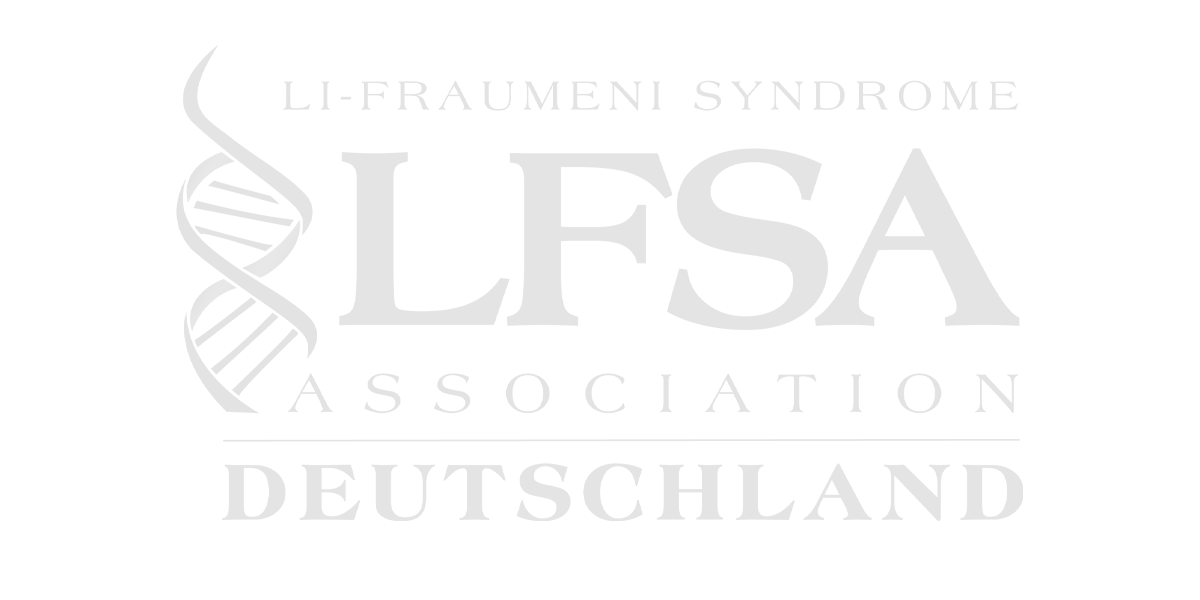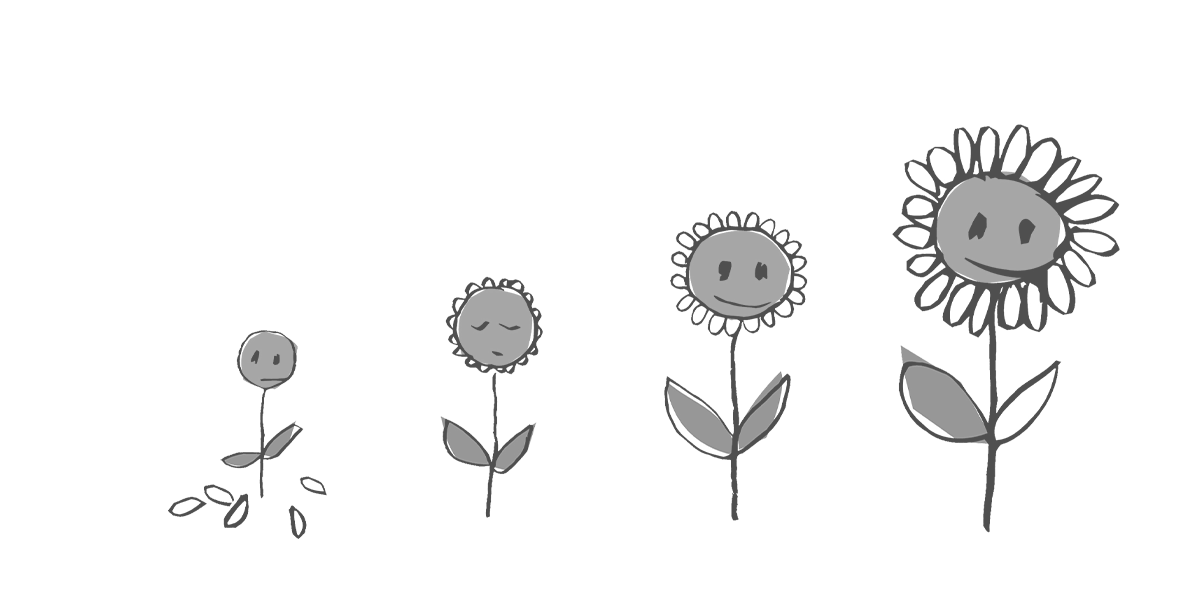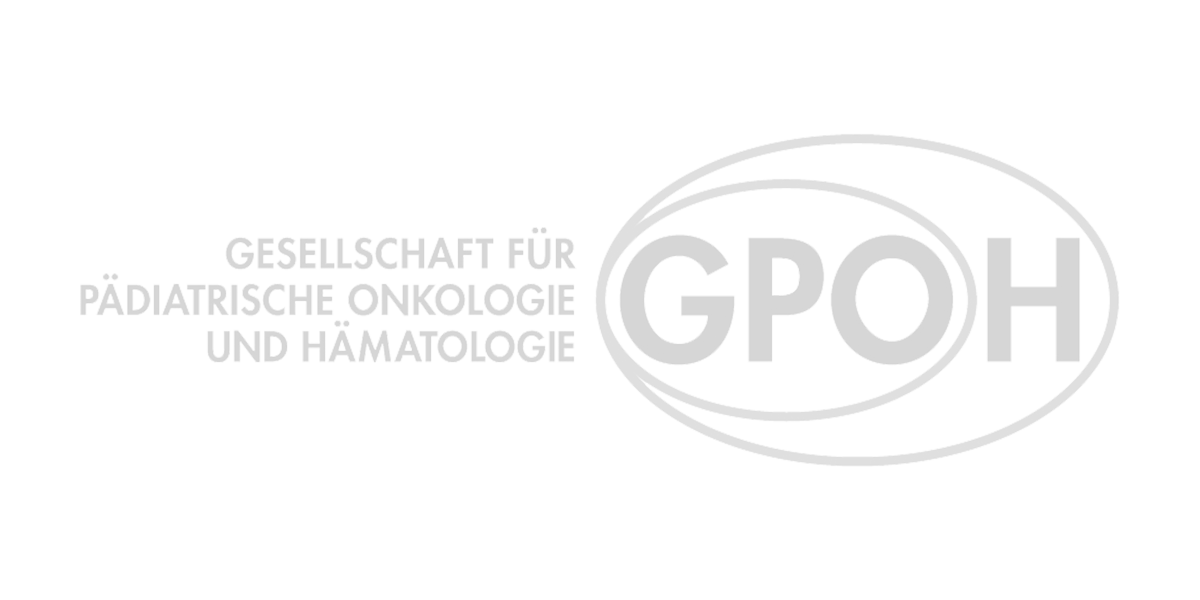"Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome" – was ist das?
Hereditäre Phäochromozytom/Paragangliom-Syndrome (HPP) sind Erkrankungen, die auf Mutationen, also genetischen Veränderungen in einem SDH-Gen, dem MAX– oder dem TMEM127-Gen beruhen. Sie sind charakterisiert durch meist gutartige Tumoren, die aus Vorläuferzellen der Nervenzellen des unwillkürlichen Nervensystems entstehen. Diese sogenannten Phäochromozytome und Paragangliome können im Bereich des Gehirns, des Halses oder der oberen Brusthöhle auftreten und produzieren dann in der Regel keine Hormone. Treten sie im Bereich der unteren Brusthöhle, des Bauches oder des Beckens auf, werden von den Tumoren meist Hormone (z.B. Adrenalin und/oder Noradrenalin) freigesetzt. Daneben besteht ein erhöhtes Risiko für Tumore des Magens, der Nieren und der Schilddrüse.
Wie wird die Diagnose "Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome" gestellt?
Verdachtsdiagnose
Der Verdacht auf das Vorliegen von HPP besteht bei folgenden Befunden:
- Beidseitige oder mehrere Paragangliome/Phäochromozyzome
- Paragangliome/Phäochromozytome an mehreren Orten, die zeitgleich oder zeitversetzt auftreten
- Wiederkehrende Paragangliome/Phäochromozytome
- Frühes Auftreten von Paragangliomen/Phäochromozytomen (<45 Jahre)
- Familiär gehäuftes Auftreten von Paragangliomen/Phäochromozytomen
Genetische Diagnostik
Die Diagnose „Hereditäre Phäochromozytom/Paragangliom-Syndrome“ gilt als gesichert bei einer nachgewiesenen Mutation, also genetischen Veränderung in einem der SDHx-Gene (SDHA, SDHB, SDHC, SDH oder SDHAF2), im MAX– oder TMEM127-Gen.
Wie hoch ist das Krebsrisiko?
Im Vergleich zu sporadisch auftretenden Paragangliomen und Phäochromozytomen (PGL/PHEO) treten die Tumore im Rahmen einer SDHx-Mutation zu einem früheren Zeitpunkt auf, sie sind eher an mehreren Orten lokalisiert, entwickeln sich beidseitig und neigen zu Rezidiven. Gutartige Paragangliome und Phäochromozytome sind in der Regel langsam wachsend, wohingegen bösartige Tumore typischerweise aggressiver sind.
Das größte Krebsrisiko besteht bei Mutationen im SDHB-Gen. Patient:innen mit dieser genetischen Veränderung weisen höhere Sterberaten auf und haben Paragangliome mit deutlich stärkerer Neigung zur Tumorstreuung (Metastasierung) als Patient:innen mit anderen SDH-Mutationen.
Paragangliome im Bereich der Hirnbasis und des Halses
Paragangliome in diesen Regionen sind generell mit dem parasympathischen Nervensystem assoziiert, welches – neben dem sympathischen Nervensystem – Teil des unwillkürlichen Nervensystems ist. Bei diesen Paragangliomen besteht in der Regel keine Freisetzung von Hormonen. Klinische Symptome werden typischerweise durch das raumfordernde Wachstum dieser Tumore verursacht, da keine Tendenz zur Streuung (Metastasierung) der Tumoren besteht.
Je nach Lokalisation können verschiedene Symptome auftreten.
Im Bereich der Halsschlagader (Karotisgabeltumore) sind die Paragangliome meist symptomlose, einseitige Raumforderungen, die erst bei wachsender Tumorgröße zu Beschwerden wie Empfindungsstörungen oder motorischen Einschränkungen im Hals-, Kiefer- und Gesichtsbereich führen.
Tumore, die im Bereich des Nervus Vagus (der zehnte Hirnnerv, der eine Vielzahl von motorischen und sensiblen Qualitäten hat) lokalisiert sind, äußern sich wie die oben beschriebenen Karotisgabeltumore. Zusätzlich können Symptome wie Heiserkeit, ein Fremdkörpergefühl im Hals, Schluckstörungen, Stimmstörungen, Schmerzen, Husten und Aspiration (Eindringen von Flüssigkeit oder Nahrung in die Atemwege) auftreten.
Im Bereich des Ohres können Paragangliome Tinnitus oder Hörverlust auslösen.
Paragangliome im Bereich des Oberkörpers, Bauches und Beckens
Paragangliome in diesen Regionen sind in der Regel mit dem sympathischen Nervensystem assoziiert, welches – neben dem parasympathischen Nervensystem – Teil des unwillkürlichen Nervensystems ist. Tumoren in diesen Bereichen weisen meist eine Überproduktion von Hormonen (z.B. Adrenalin und/oder Noradrenalin) auf.
Phäochromozytome und sympathische Paragangliome außerhalb der Nebenniere
Phäochromozytome sind Tumore, die meist im Nebennierenmark auftreten und Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin (Katecholamine) produzieren. Sie können jedoch auch außerhalb der Nebennieren auftreten als sogenannte sympathische Paragangliome. Diese Art von Tumoren präsentiert sich im Rahmen von HPP in gleicher Weise wie bei sporadischem Auftreten. Sie fallen meist durch eines der folgenden Szenarien auf:
- Zeichen und Symptome, die mit einer Überproduktion von Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin) assoziiert sind, wie hoher Blutdruck und schneller Puls, Kopfschmerzen, spürbares Herzstolpern, extremes Schwitzen und Angst. Auch Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Gewichtsverlust können durch einen solchen Tumor ausgelöst werden.
- Zeichen und Symptome, die durch das Größenwachstum des Tumors verursacht werden
- Zufallsbefund bei MRT/CT
- Screening bei Verwandten mit erhöhtem Risiko
Sympathische Paragangliome außerhalb der Nebenniere haben eine erhöhte Tendenz zur bösartigen Entartung. Bei Phäochromozytomen ist diese Tendenz deutlich geringer.
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
Es handelt sich hierbei um bösartige Bindegewebstumoren des Magen-Darm-Traktes, die im Rahmen von HPP meist im Magen lokalisiert sind. Als Komplikation können Magenblutungen auftreten. Diese Tumore können bei Mutationen in allen SDH-Genen auftreten, sind aber bei Mutationen im SDHA-Gen am häufigsten.
Klarzelliges Nierenzellkarzinom und papilläres Schilddrüsenkarzinom
Diese Tumore sind im Rahmen von SDHB– und SDHD-Mutationen beschrieben worden.
Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome – was ist über die Entstehung bekannt?
Die hereditären Phäochromozytom/Paragangliom-Syndrome beruhen auf Mutationen, also genetischen Veränderungen eines SDH-Gens, des MAX– oder TMEM127-Gens. Diese Gene kodieren für die entsprechenden SDH-Proteine bzw. die Proteine MAX und TMEM127, welche alle als Tumorsuppressoren fungieren, also die Vermehrung der Zellen in unserem Körper kontrollieren. Liegt nun eines der Gene in einer veränderten Form vor, kann auch das entsprechende Protein nicht mehr korrekt als Tumorsuppressor funktionieren und es kommt zur Entstehung von Neubildungen aus Vorläuferzellen des unwillkürlichen Nervensystems.
HPP können von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden. Der Erbgang ist dabei autosomal-dominant. Genetische Veränderungen in den Genen SDHD, SDHAF2 und MAX werden nur von der väterlichen Seite vererbt.
Etwa 65% der Fälle liegt eine Spontan- oder Neumutation, man nennt das de novo Mutation, zugrunde.
Hormonproduzierende Tumoren
- Medikamentöse Therapie zur Vermeidung einer überschießenden Hormonfreisetzung
- Bei bösartigen Tumoren chirurgische Entfernung
Nicht-hormonproduzierende Paragangliome der Hirnbasis und des Halses
- Frühzeitige chirurgische Therapie
- Paragangliome im Bereich der Halsschlagader und des zehnten Hirnnervs
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
Bei älteren Patient:innen oder bei darüber hinaus vorliegenden Erkrankungen kann eine operative Therapie herausgezögert werden unter regelmäßiger bildgebender Kontrolle. Auch eine Radiotherapie kann bei diesen Patient:innen in Erwägung gezogen werden.
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
- Paragangliome im Bereich des Ohres
- Kleine Tumoren können meist problemlos chirurgisch entfernt werden.
- Bei größeren Tumoren können durch die chirurgische Entfernung Komplikationen auftreten wie der Austritt von Nervenwasser, Hirnhautentzündung, Schlaganfall, Hörverlust und Hirnnervenlähmung.
Phäochromozytome
- Frühzeitige chirurgische Therapie
- Paragangliome im Bereich der Halsschlagader und des zehnten Hirnnervs
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
Bei älteren Patienten oder bei darüber hinaus vorliegenden Erkrankungen kann eine operative Therapie herausgezögert werden unter regelmäßiger bildgebender Kontrolle. Auch eine Radiotherapie kann bei diesen Patienten in Erwägung gezogen werden.
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
- Paragangliome im Bereich des Ohres
- Kleine Tumoren können meist problemlos chirurgisch entfernt werden.
- Bei größeren Tumoren können durch die chirurgische Entfernung Komplikationen auftreten wie der Austritt von Nervenwasser, Hirnhautentzündung, Schlaganfall, Hörverlust und Hirnnervenlähmung.
Patienten mit SDHB-Mutation
Diese Patient:innen sollten nach Diagnose eines Tumors so rasch wie möglich operativ therapiert werden, da bei Tumoren im Rahmen einer SDHB-Mutation eine starke Tendenz zur Metastasierung besteht.
Gibt es eine Therapie?
Die Therapie von erblichen Paragangliomen und Phäochromozytomen unterscheidet sich nicht wesentlich von der sporadisch auftretender Tumore. Empfohlen wird bei Kindern die Kontaktaufnahme mit der GPOH-Studie für endokrine Tumore durch Ihr Behandlungsteam.
Hormonproduzierende Tumoren
- Medikamentöse Therapie zur Vermeidung einer überschießenden Hormonfreisetzung
- Bei bösartigen Tumoren chirurgische Entfernung
Nicht-hormonproduzierende Paragangliome der Hirnbasis und des Halses
- Frühzeitige chirurgische Therapie
- Paragangliome im Bereich der Halsschlagader und des zehnten Hirnnervs
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
Bei älteren Patient:innen oder bei darüber hinaus vorliegenden Erkrankungen kann eine operative Therapie herausgezögert werden unter regelmäßiger bildgebender Kontrolle. Auch eine Radiotherapie kann bei diesen Patient:innen in Erwägung gezogen werden.
- Chirurgische Entfernung ist Therapie der Wahl. Meist ist diese vollständig möglich.
- Paragangliome im Bereich des Ohres
- Kleine Tumoren können meist problemlos chirurgisch entfernt werden.
- Bei größeren Tumoren können durch die chirurgische Entfernung Komplikationen auftreten wie der Austritt von Nervenwasser, Hirnhautentzündung, Schlaganfall, Hörverlust und Hirnnervenlähmung.
Phäochromozytome
- Chirurgische Entfernung, idealerweise mittels Bauchspiegelung, ist die Therapie der Wahl.
- Vor der Operation sollte eine antihormonelle medikamentöse Therapie durchgeführt werden.
Patient:innen mit SDHB-Mutation
Diese Patient:innen sollten nach Diagnose eines Tumors so rasch wie möglich operativ therapiert werden, da bei Tumoren im Rahmen einer SDHB-Mutation eine starke Tendenz zur Metastasierung besteht.
Diagnose Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose wenden Sie sich bitte unbedingt an eine:n Spezialist:in für dieses Krebsprädispositionssyndrom. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem geben wir Ihnen ein paar Tipps, was Sie selber tun können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns oder Ihren behandelnden Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin.
Diagnose Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose wenden Sie sich bitte unbedingt an eine:n Spezialist:in für dieses Krebsprädispositionssyndrom. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem geben wir Ihnen ein paar Tipps, was Sie selber tun können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns oder Ihren behandelnden Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin.
Medizinische Maßnahmen zur Früherkennung
Da sich Tumore nur selten in den ersten zehn Lebensjahren entwickeln, schlägt die American Association of Cancer Research (AACR) aktuell einen Beginn der Früherkennungsuntersuchungen im Alter von 6-8 Jahren vor. Diese Empfehlungen sind einheitlich und unabhängig von der vorliegenden genetischen Mutation.
Paragangliome / Phäochromozytome
- Blutdruckkontrollen bei jeder ärztlichen Vorstellung (mindestens jährlich) ab 6-8 Jahren
- Jährlich Blut- oder Urinuntersuchung auf Hormone der Nebenniere ab 6-8 Jahren
-
- Bei Auffälligkeiten sollte je nach Werten eine Bildgebung bzw. eine Wiederholung der Untersuchung nach 2 bzw. 6 Monaten erfolgen.
- Alle zwei Jahre Ganzkörper-MRT (Schädelbasis bis Becken) ab 6-8 Jahren
- Optional: Alle zwei Jahre MRT-Hals mit/ohne Kontrastmittel
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
- Jährlich großes Blutbild ab 6-8 Jahren
Hereditäre Phäochromozytom/ Paragangliom-Syndrome – was Sie selber tun können
Darauf sollten Sie achten
Sie sollten eine:n Ärzt:in aufsuchen, sobald Beschwerden wie hoher Blutdruck und schneller Puls, Kopfschmerzen, spürbares Herzstolpern, extremes Schwitzen oder Angst auftreten. Auch Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Gewichtsverlust können Zeichen eines hormonproduzierenden Tumors sein und sollten ärztlich abgeklärt werden. Daneben sollten auch Tinnitus oder Hörveränderungen, Schluck- oder Stimmstörungen, Heiserkeit, Husten oder ein Fremdkörpergefühl im Hals wahrgenommen und einem Arzt oder einer Ärztin berichtet werden. Auch bei weiteren neu auftretenden Auffälligkeiten oder Beschwerden, z.B. Bauchschmerzen, Empfindungsstörungen oder motorischen Einschränkungen sollten Sie dringend eine:n Ärzt:in aufsuchen.
Weitere Informationen
Leider gibt es bislang keine uns bekannten Selbsthilfegruppen für Patient:innen mit Hereditärem Phäochromozytom/Paragangliom-Syndromen. Sobald uns neue Informationen zur Verfügung stehen, werden wir diese hier ergänzen. Patient:innen können sich jedoch jederzeit für das KPS-Register anmelden oder dies durch die betreuenden Ärztinnen und Ärzte vornehmen lassen.
Weitere Fragen?
Wir sind für Sie per E-Mail und telefonisch erreichbar. Zudem können Sie persönlich in unsere Sprechstunden kommen. Weitere Informationen entnehmen Sie am besten unserer Kontaktseite.