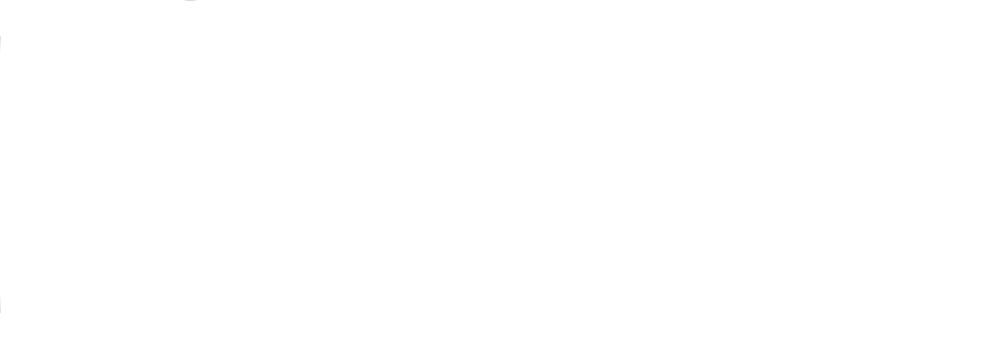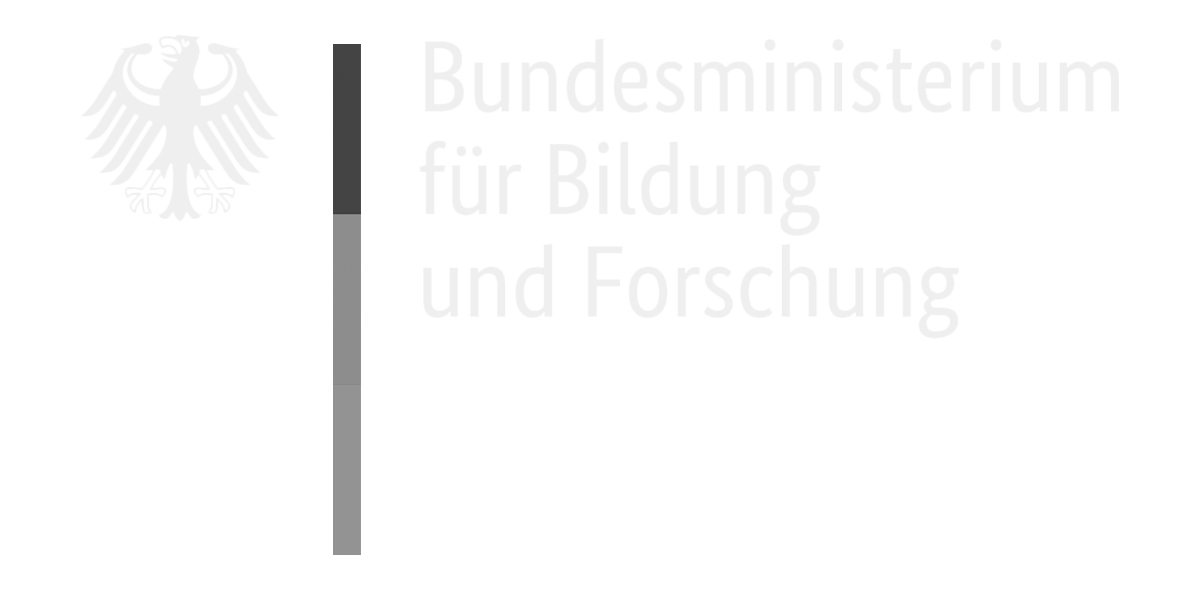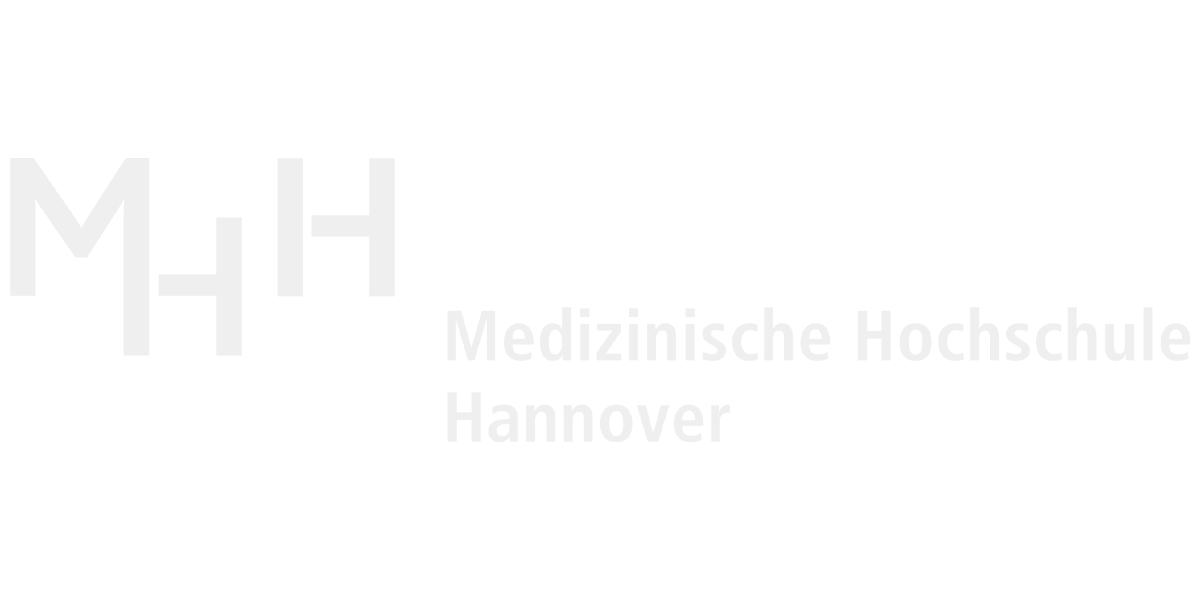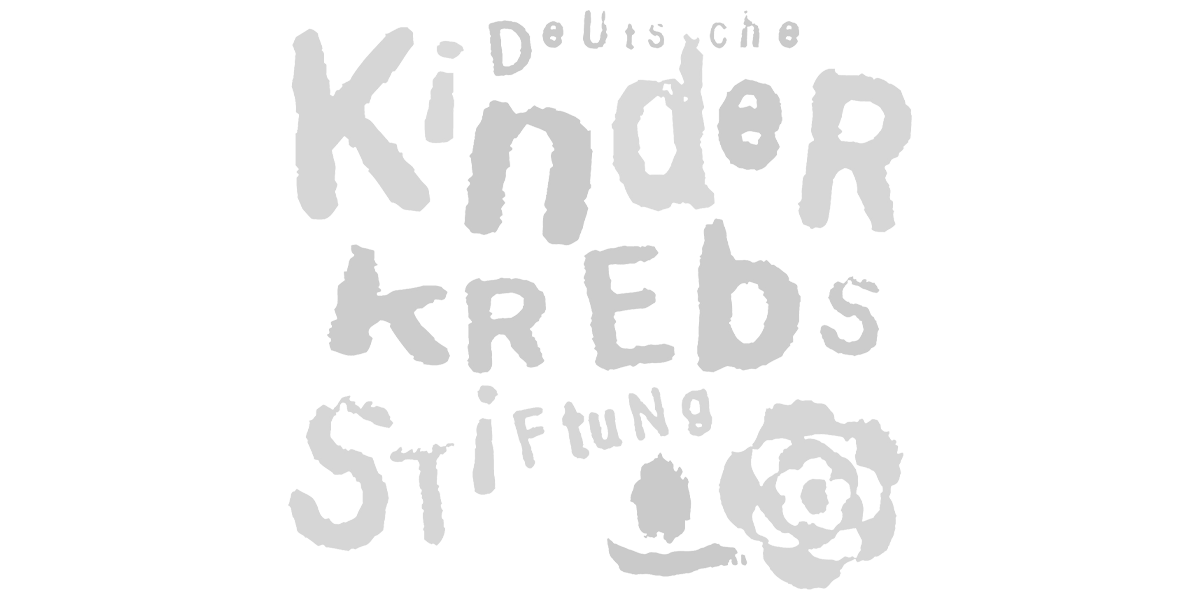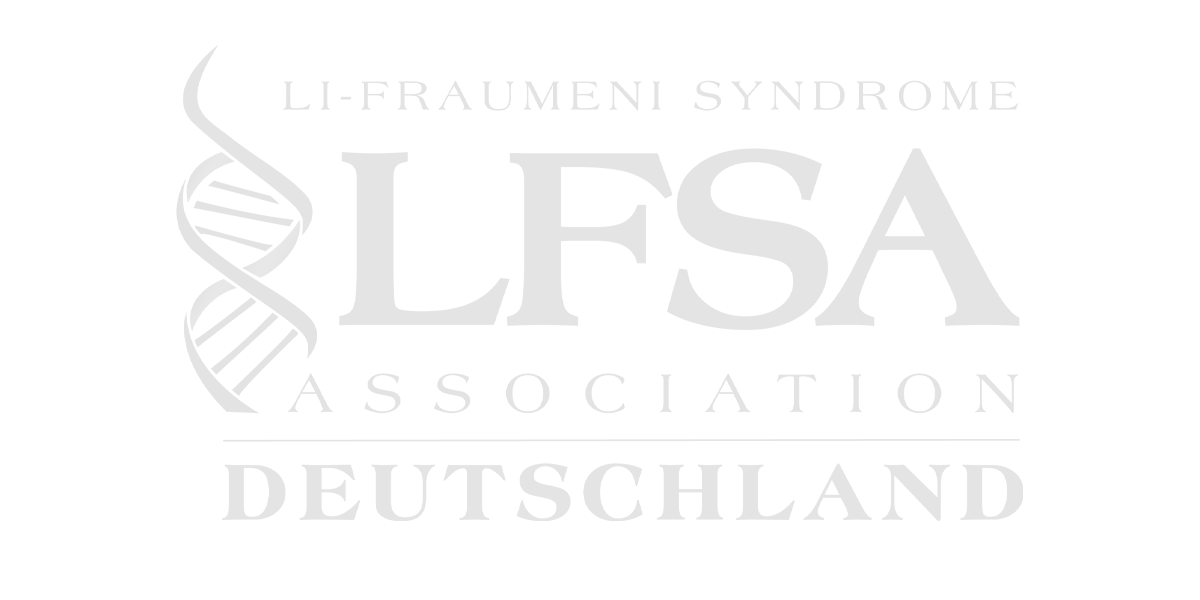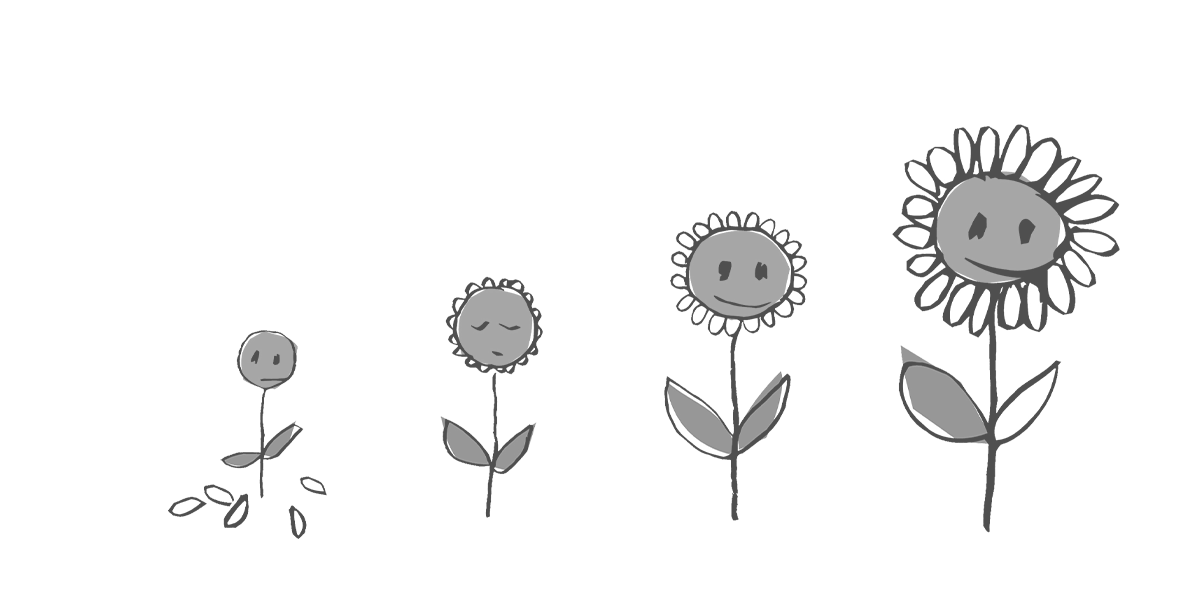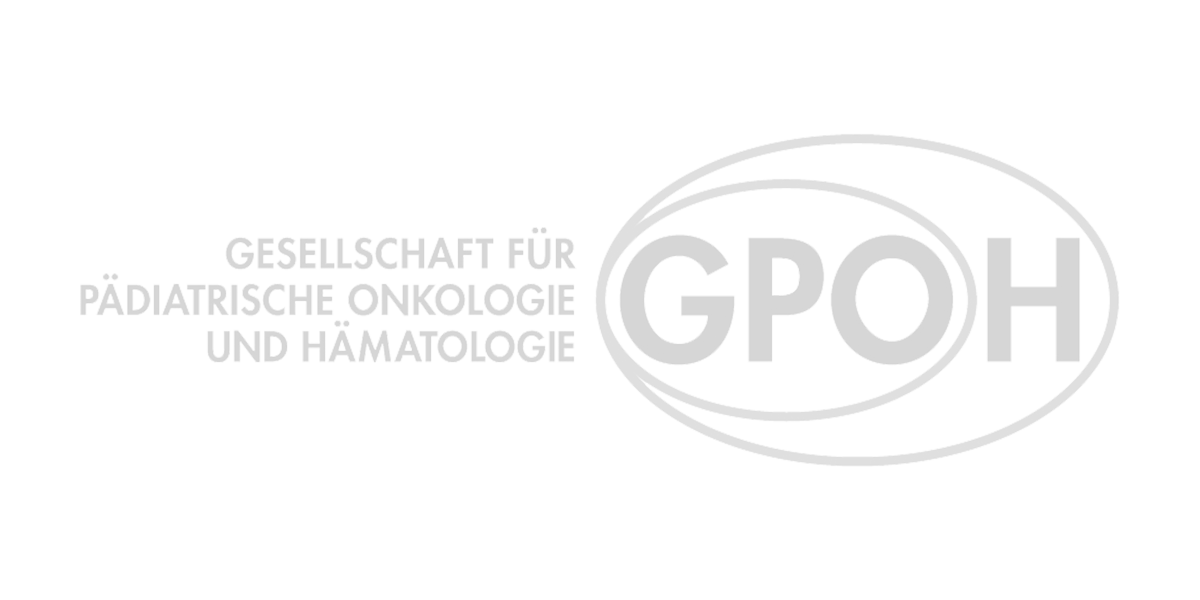Dyskeratosis congenita – Definition
Die Dyskeratosis congenita (OMIM: #127550, #30500, #615190, #613987, #613989) ist eine Telomeropathie, die durch die klinisch klassische Triade von Nageldystrophien, oraler Leukoplakie und Pigmentstörungen im Bereich der oberen Thoraxapertur und zervikal charakterisiert ist. Es besteht ein erhöhtes Risiko für ein progressives Knochenmarksversagen und die Entwicklung myeloischer Neoplasien, solider Tumore sowie einer pulmonalen Fibrose. Die Klinik ist variable und oftmals liegt die klassische Trias nicht vor.
Synonyme:
DC, Telomeren-Syndrome, Zinsser-Cole-Engman-Syndrom
Gene:
ACD, CTC1, DKC1, NHP2, NOP10, PARN, RTEL1, TERC, TERT, TINF2, WRAP53 (30% der Fälle mit klinischer DC sind aktuell genetisch noch nicht klassifiziert)
Genprodukte:
Alle Genprodukte spielen in der Telomerbiologie eine Rolle. TERC kodiert für eine RNA.
Funktion:
Stabilität und Erhalt der Telomere, die ihrerseits essentiell für die chromosomale Stabilität sind
Erbgang:
- X-gebunden: DKC1
- autosomal-dominant: TERC und TINF2
- autosomal-dominant oder autosomal-rezessiv: ACD, RTEL1, TERT
- autosomal-rezessiv: CTC1, NHP2, NOP10, PARN und WRAP53
Prävalenz:
in 2015 weltweit mindestens 400 Familien
Genotyp-Phänotyp-Korrelation:
Umfassende Studien fehlen. Schwere Verlaufsformen (kürzere Telomere als die klassische DC):
- Hoyeraal-Hreidarsson-Syndrom
- Revesz-Syndrom
Penetranz:
Bislang nicht gut verstanden. Hohe interindividuelle und innerfamiliäre Variabilität, und bei altersabhängigen Symptombeginn, scheinbare inkomplette Penetranz. Phänomen der Antizipation.
Dyskeratosis congenita – Diagnosestellung
Klassische DC-Diagnose-Trias (nicht präsent in allen DC-Patient:innen)
- Nageldysplasien
- Pigmentstörungen, zervikal/obere Thoraxapertur
- Orale Leukoplakie
Diagnostik
- Leukozyten Telomer-Längen-Testung (Multicolor flow-FISH, PCR oder Restriktionsfragmentanalyse). Eine Lymphozyten Telomerlänge unterhalb der ersten Altersperzentile ist 97% sensitiv und 91% spezifisch für eine DC.
- Molekulargenetische Testung (serielle Einzelgen-Testung, Multigen-Panel, Exom-/Genom-Sequenzierung)
Differentialdiagnosen
- Angeborene Knochenmarkversagen (Fanconi-Anämie, Diamond-Blackfan-Anämie, Shwachman-Diamond-Syndrom)
- Erworbene Knochenmarkversagen
- Idiopathische pulmonale Fibrose (IPF)
- Erkrankungen, die mit Nageldystrophien einhergehen (Nagel-Patella-Syndrom, 20-Nägel-Dystrophie, Keratodermie mit Nageldystrophie und sensomotorischer Neuropathie, Poikilodermie mit Neutropenie).
Klinische Präsentation
Typische Präsentation
- Progredientes Knochenmarkversagen: Thrombopenie, Leukopenie, Anämie (50% bis zum 40. LJ)
- Lunge: Idiopathische pulmonale Fibrose (65%), Bronchiolitis obliterans, chronische Hypersensitivitätspneumonien, Emphyseme
- Leber: Histologisches heterogenes Bild einer Inflammation, Hämochromatose, Hepatozytennekrose, Fibrose, noduläre regenerative Hypoplasie
- Dermatologie: Nageldystrophien, Pigmentstörungen, Hyperhidrose
- Wachstum & Entwicklung: Kleine Statur, Wachstums- (auch intrauterin) und Entwicklungsretardierung
- Auge: Epiphora, abnormes Wimpernwachstum, bilaterale exsudative Retinopathie
- HNO: Orale Leukoplakie, Taubheit (selten)
- Kardiovaskulär: ASD, VSD, myokardiale Fibrose, dilatative Kardiomyopathie
- Gastrointestinal: Ösophageale Stenosen, Enteropathie, Leberfibrose, Hepatopulmonales Syndrom (HPS), Gefäßektasien, teils lebensbedrohliche gastrointestinale Blutungen
- Urogenital: Urethralstenose
- Muskuloskelettal: Osteoporose, Osteopenie, avaskuläre Nekrosen in Schulter und Hüfte
- Psychiatrie: Schizophrenie
- Endokrin: Hypogonadismus
- Immunologie: Immundefizienz
Schwere Verlaufsformen
- Hoyeraal-Hreidarsson-Syndrom: Frühkindlicher Beginn, zusätzlich zu den klassischen DC-Merkmalen zerebelläre Hypoplasie, Entwicklungsretardierung, Immundefizienz, intrauterine Wachstumsretardierung, Knochenmarkversagen
- Revesz-Syndrom: Frühkindlicher Beginn, zusätzlich zu den Merkmalen der DC bilaterale exsudative Retinopathie, intrakraniale Kalzifikationen, intrauterine Wachstumsretardierung, Knochenmarkversagen, schütteres dünnes Haar, Nageldystrophien, orale Leukoplakie
Krebsprädisposition
- Myeloische Neoplasien (MDS, AML)
- Plattenepithel-Karzinome und Adenokarzinome des Oropharynx (HNSCC), GI-Traktes und Anogenitalbereiches
- Das Risiko für eine maligne Erkrankung ist 11-fach erhöht im Vergleich zu der gesunden Bevölkerung. Auftreten ab der 3. Lebensdekade.
Besonderheiten bei der Behandlung
- Monatliche orale Selbstkontrolle auf Schleimhautveränderungen
- Therapie entsprechend der Manifestation
- Androgene/KMT bei Knochenmarkversagen
- Vermeidung von Blutkonserven von Familienspendern, wenn eine KMT erwogen wird
- Keine Kombiantion von Androgenen und G-CSF (Assoziation mit Milzruptur)
- Kanzerogene Noxen meiden (Nikotin, Alkohol)
Diagnose Dyskeratosis congenita. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose ist es ratsam, die Weiterbehandlung von betroffenen Patient:innen durch eine:n Spezialist:in für dieses Krebsprädispositionssyndrom durchführen zu lassen. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem finden Sie am Ende dieser Seite noch ein paar weiterführende Informationen wie z.B. die Links von Selbsthilfegruppen.
Diagnose Dyskeratosis congenita. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose ist es ratsam, die Weiterbehandlung von betroffenen Patient:innen durch eine:n Spezialist:in für dieses Krebsprädispositionssyndrom durchführen zu lassen. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem finden Sie am Ende dieser Seite noch ein paar weiterführende Informationen wie z.B. die Links von Selbsthilfegruppen.
Empfehlungen zur Früherkennung bei Ihren Patient:innen
Evidenzbasierte Standards für ein Tumorscreening und klinisches Management fehlen aufgrund der Rarität der Erkrankung. Nachfolgend finden Sie eine Empfehlung aus dem Konsensus-Meeting der AACR vom Oktober 2016.
< Tabelle seitlich verschiebbar >
Hämato-Onkologie |
Anamnese und körperliche Untersuchung, jährliches Blutbild, jährliche Knochenmarkpunktion- und -stanzbiopsie bei Diagnose und entsprechend klinischer Symptome, frühzeitige Überweisung in ein Transplantationszentrum, HPV-Impfung, jährliche HNO-Kontrollen ab Adoleszenz (HNSCC-Evaluation) |
Immunologie |
Monitoring der Immunglobulin-Level entsprechend immunologischer Empfehlungen |
Dermatologie |
Jährliches Hautscreening |
Pulmologie |
Baseline-Funktionstestung mit regelmäßigen Routine Follow-up |
Gastroenterologie & Nutrition |
Jährliche Leberfunktionstestung, unter Androgentherapie häufiger (halbjährliche Leber-Sonographie, 3-monatliche Leberfunktionstestung) |
Endokrinologie |
Jährliches Diabetesscreening, Wachstums-Monitoring |
Neurologie |
cMRT-Untersuchung auf zerebelläre Hypoplasie bei Diagnose, frühzeitige Supportivtherapie bei Entwicklungsretardierung |
Ophthalmologie |
Jährliche Untersuchungen, Monitoring und frühzeige Intervention bei Tränengangstenose |
Orthopädie |
Evaluation von aseptischen Knochennekrosen der Hüfte und Schulter nach Klinik |
Zahnarzt |
Halbjährliche Kontrollen |
HNO |
Baseline Hörstatus |
Kardiologie |
Baseline Evaluation auf AV- und kardiale Malformationen |
Urogenitaltrakt |
Baseline Untersuchung auf urogenitale Fehlbildungen |
Gynäkologie |
Jährliche Untersuchung |