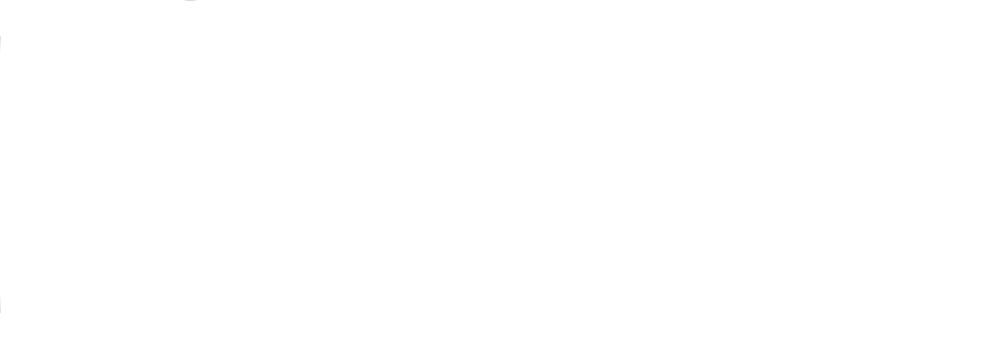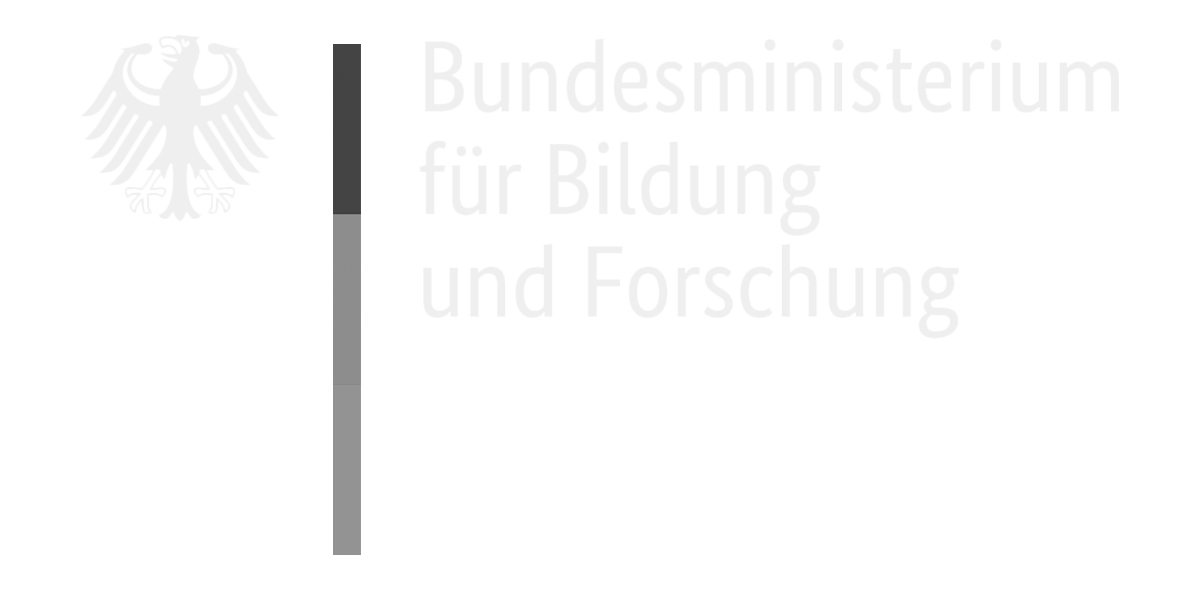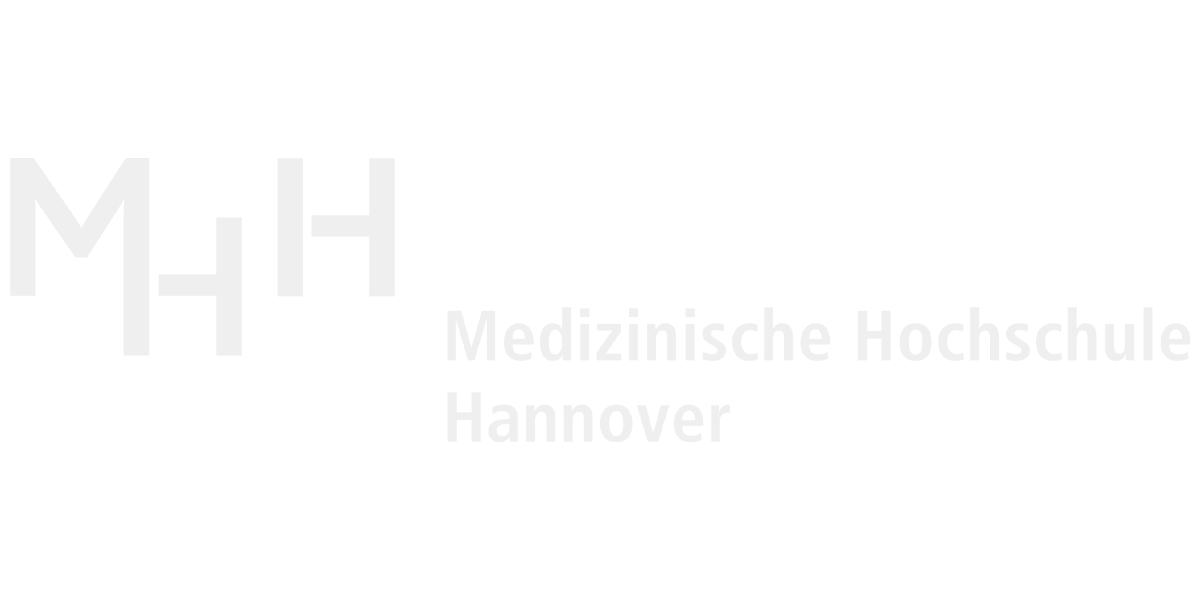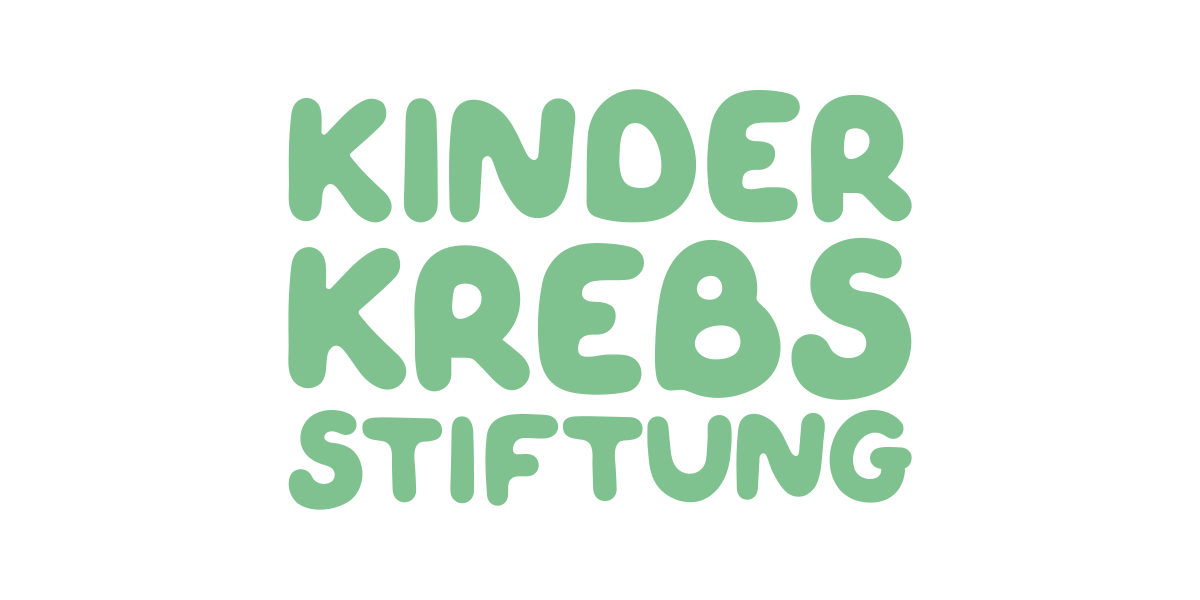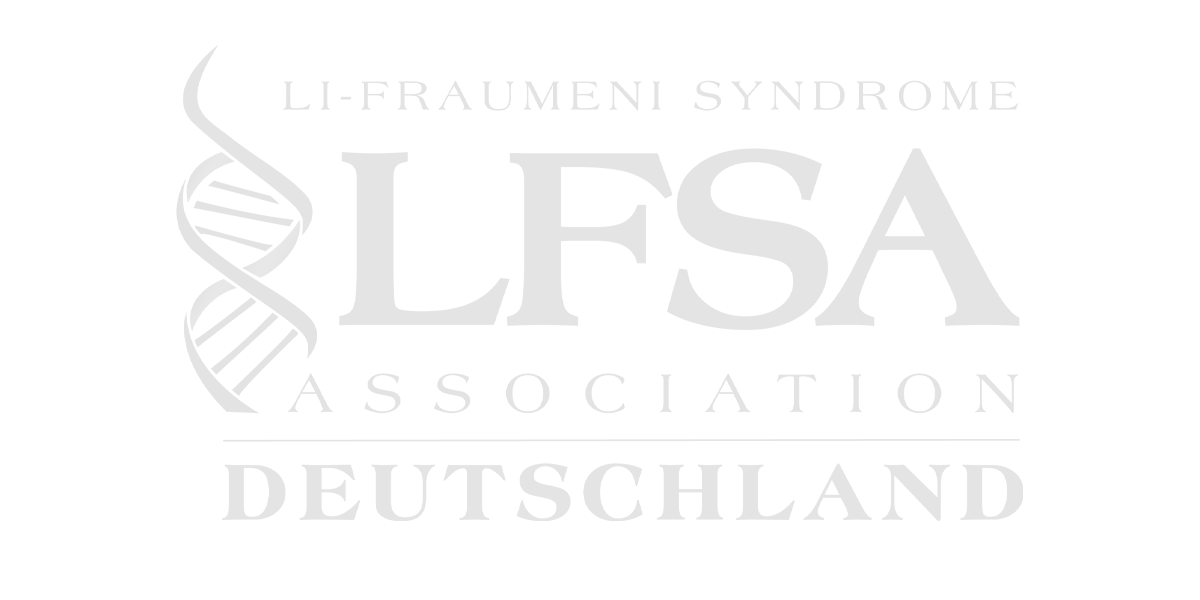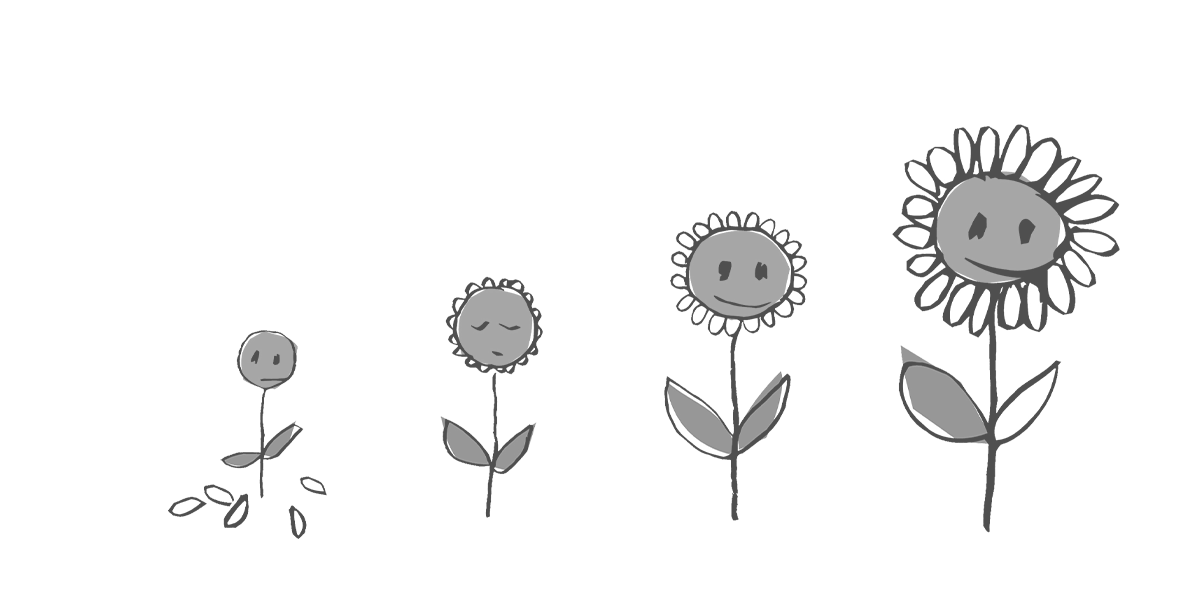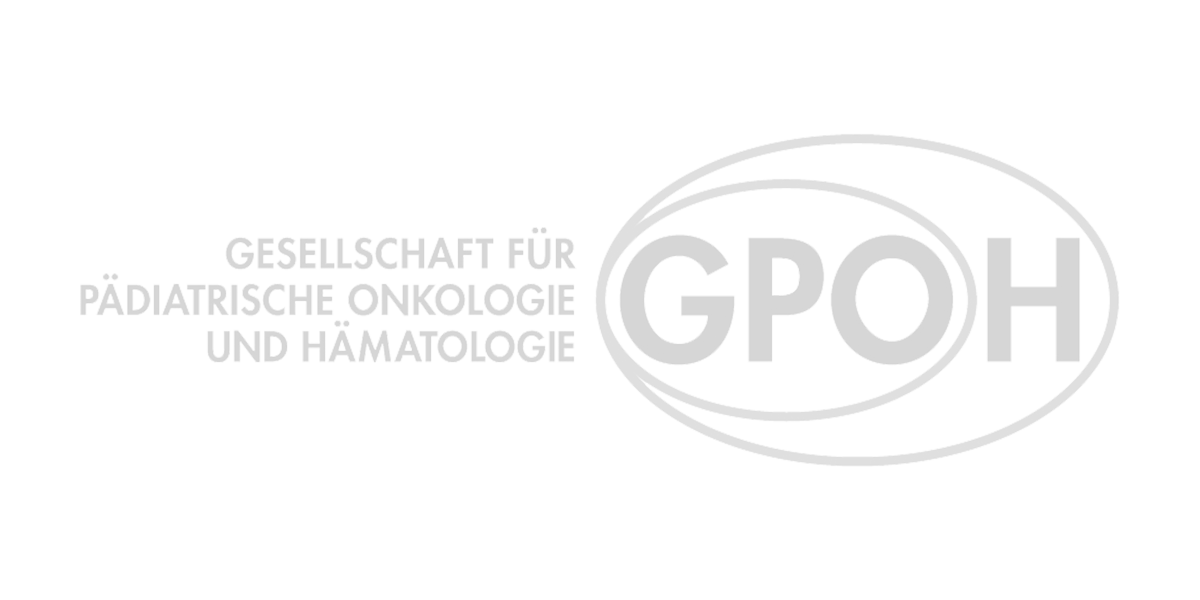L-2-Hydroxyglutar Azidurie – Definition
Die L-2-Hydroxyglutar Azidurie (L2HGA, OMIM #236792) ist eine neurometabolische genetische Erkrankung, die auf pathogene Varianten im L2HGDH-Gen beruht. Sie ist gekennzeichnet durch zerebelläre Ataxie, psychomotorische Retardierung, Epilepsie sowie Makrozephalie unterschiedlich starker Ausprägung.
Synonyme:
L-2-Hydroxyglutar Azidämie
Gen:
L2HGDH (L-2-Hydroxyglutarat-Dehydrogenase-Gen)
Genprodukte:
L2HGDH (L-2-Hydroxyglutarat-Dehydrogenase)
Funktion:
L2HGDH katalysiert die Konversion von L-2-Hydroxyglutarsäure (L2HG) in 2 Ketoglutarat. Die Funktion von L2HG ist bisher nicht bekannt.
Erbgang:
autosomal-rezessiv
Prävalenz:
<1:1.000.000
Genotyp-Phänotyp-Korrelation:
Insgesamt bestehen nur geringe phänotypische Unterschiede
Die Urin-Ausscheidung von L2HG ist bei Patientinnen und Patienten mit pathogener c.905C>T-Variante deutlich geringer als bei Patientinnen und Patienten mit pathogener c.530_533delinsATT-Variante, jedoch zeigen sich keine phänotypischen Unterschiede.
Penetranz:
Alle Betroffenen weisen erhöhte L-2-Hydroxyglutarsäurespiegel im Urin auf.
L-2-Hydroxyglutar Azidurie – Diagnosestellung
Laborchemische Diagnostik
Im Screening auf organische Säuren zeigen sich in Urin, Plasma und Liquor massiv erhöhte Spiegel für 2-L-Hydroxyglutarsäure. Darauffolgend kann durch chimäre Auftrennung die Diagnose L2HGA biochemisch gesichert werden.
Bildgebende Diagnostik
Typische Befunde in kranialer CT und MRT sind eine subkortikale Leukenzephalopathie, subkortikale und paraventrikuläre Intensitätssteigerungen sowie eine Kleinhirnatrophie.
Genetische Diagnostik
Die Diagnose „L-2-Hydroxyglutar Azidurie“ wird gesichert durch den Nachweis einer pathogene Keimbahnvariante des L2HGDH-Gens durch Sequenzanalyse, PCR (polymerase chain reaction) oder MLPA (multiplex ligation dependent probe amplification).
Differentialdiagnosen
- D-2-Hydroxyglutar Adzidurie
- Neurometabolische Erkrankungen anderer Ursache
Klinische Präsentation
Die L-2-Hydroxyglutar Azidurie fällt meist klinisch innerhalb des ersten Lebensjahres durch eine psychomotorische Retardierung, epileptische Anfälle oder zerebelläre Ataxie auf. Bei etwa der Hälfte der Patientinnen und Patienten liegt eine Makrozephalie vor. Weitere Symptome sind muskuläre Hypotonie meist im früheren Krankheitsstadium, extrapyramidale Symptome, Verhaltensauffälligkeiten und Spastiken, die eher im späteren Verlauf auftreten. Es zeigt sich insgesamt ein langsamer Krankheitsprogress und die meisten Betroffenen erreichen das Erwachsenenalter. Es kann jedoch im Verlauf zum vollständigen Verlust motorischer Fähigkeiten (z.B. Verlust der Gehfähigkeit) sowie Sprachproblemen kommen.
Daneben zeigt sich eine Assoziation der L2HGA mit verschiedenen Hirntumoren wie Ependymomen, primitiv neuroektodermalen Tumoren, low- und high-grade Gliomen, Medulloblastomen und Oligodendrogliomen. Das genaue Tumorrisiko ist bisher nicht bekannt.
Laborchemisch ist die L2HGA gekennzeichnet durch hohe Spiegel von L-2-Hydroxyglutarsäure in Urin, Plasma und Liquor.
Besonderheiten bei der Behandlung
Bisher ist keine kausale Therapie bekannt, so dass sich die Behandlung auf eine supportive symptomorientierte Therapie beschränkt.
Diagnose L-2-Hydroxyglutar Azidurie. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose ist es ratsam, die Weiterbehandlung von Betroffenen durch eine Spezialistin bzw. einen Spezialisten für dieses Krebsprädispositionssyndrom durchführen zu lassen. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem finden Sie am Ende dieser Seite noch ein paar weiterführende Informationen wie z.B. die Links von Selbsthilfegruppen.
Diagnose L-2-Hydroxyglutar Azidurie. Wie geht es weiter?
Nach der Diagnose ist es ratsam, die Weiterbehandlung von Betroffenen durch eine Spezialistin bzw. einen Spezialisten für dieses Krebsprädispositionssyndrom durchführen zu lassen. Im folgenden Abschnitt schildern wir Ihnen, ob Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung oder andere Maßnahmen erforderlich sind und wie diese erfolgen sollten. Zudem finden Sie am Ende dieser Seite noch ein paar weiterführende Informationen wie z.B. die Links von Selbsthilfegruppen.
Empfehlungen zur Früherkennung
Im Hinblick auf das erhöhte Risiko für Hirntumore sollte eine klinische und neurologische Untersuchung alle 3-6 Monate erfolgen. Darüber hinaus wird die jährliche Durchführung einer kranialen MRT empfohlen (initial mit Kontrastmittel, danach ohne KM solange keine Auffälligkeiten gefunden werden).